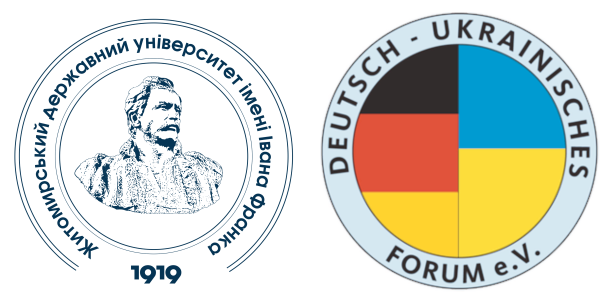Können Sie bitte etwas über die friedlichen Demonstrationen vor 30 Jahren erzählen?
Bei uns waren die Demonstration, die sozusagen den Wandel versursacht haben, nicht 1990, sondern 1989. Aber was heißt friedlich? Um eine Diktatur zu überwinden, kann Gewalt angewandt werden, aber damit delegitimiert man sich selbst. Deshalb war für uns wichtig, friedliche Mittel einzusetzen, um demokratische Ziele zu erreichen. Das ist der Grund, weshalb immer von friedlicher Revolution gesprochen wird. Wir wollten, dass sich der Staat selbst delegitimiert, wenn er mit Gewalt reagiert. Das war aber nicht vor 30 Jahren, sondern 1989. Es war Gorbatschows neuer Weg.
Ich bin damals in Leipzig gewesen. Ich wurde durch ein Flugblatt auf die Demonstrationen aufmerksam. Das war die einzige Möglichkeit, die wir damals hatten. Damals gab es ja kein Smartphone und Internet. Die Leute, die Flugblätter verteilten, wurden, bis auf zwei Ausnahmen, noch bevor alles losging, inhaftiert. Und die Briefkästen, in die die Flugblätter gesteckt wurden, hat der Staat geleert. In keinem anderen Land war aus meiner Sicht die Staatssicherheit so massiv präsent wie in der DDR.
Aber die Inhaftierungen lösten eine Welle der Solidarität aus. Die jungen Leute, die im Januar 1989 verhaftet wurden, kamen wenige Tage später wieder aus dem Gefängnis. Die heutige OSZE hatte zur selben Zeit eine Tagung in Wien und die Opposition aus Tschechien und der Slowakei machte damals auf die Verhaftungen aufmerksam. Daraufhin sagte der amerikanische und der deutsche Außenminister, solange junge Menschen in Leipzig inhaftiert sind, können wir keinen Vertrag unterschreiben.
Ich war dann im Juni 1989 in Polen. Dort gab es bereits Wahlen und die Opposition hatte praktisch gewonnen. Der Übergangsprozess in neue politische Verhältnisse lief. Es waren keine Demonstrationen notwendig. Später bin ich weiter in die Ukraine. Ich hatte Glück, überhaupt ein Visum zu bekommen, was ich jahrelang nicht erhielt. Ich wusste gar nicht, was mir geschieht. Dort erlebte ich, wie in Lwiw an der Mariensäule für die Unabhängigkeit demonstriert wurde. Damals hieß das noch Lenin Prospekt.
Auch dort waren die ersten Demonstrationen friedlich. Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich den Eindruck, dass es in der Ukraine weit mehr Potential gab, als bei uns in Leipzig.
Sie hatten also den Eindruck, dass in der Ukraine mehr Möglichkeiten für weitere demokratische Entwicklung bestanden, als in der DDR?
Ja, genau. Das war mein Eindruck. Weil dort nämlich Tag und Nacht demonstriert wurde. Das war bei uns unmöglich. Unsere Strategie war, dass man uns nicht daran hindern konnte, Gottesdienste zu feiern. Und als wir die Kirche verließen, wurde daraus eine Demonstration. Hätte man den Zugang zu den Kirchen verwehrt, wäre daraus ein Problem zwischen Staat und Kirche entstanden und das wäre sofort international geworden. Danach versuchte es der Staat mit Polizeiketten um die Kirche. Das war eine Frage von Gewalt und von Gewaltpotenzial. Und manche sagen, dass der 9. Oktober der Tag der Entscheidung in Leipzig war. Da wurde eine Demonstration mit großer Gewalt verhindert, aber es waren hunderttausende Menschen. Da hätte man schon sehr viel Gewalt aufbringen müssen, um das zu verhindern.
Was danach passierte, verlief dann bereits über demokratische Institutionen, die wir aufgebaut hatten. Hierzu zählt zum Beispiel die Öffnung der Stasi-Akten.
Sie wurden mehrfach festgenommen wurden. Was würden Sie jemandem raten, der an politischen Protesten teilnimmt, wie jetzt zum Beispiel in Belarus?
Es gibt eine Grundregel. Wenn man alleine unterwegs ist, kann man verschwinden, ohne dass das jemand merkt. Also, alleine agieren ist zwar sehr mutig, aber nicht sehr effizient.
Man braucht so etwas wie eine soziale Lawine. Die Leute müssen in das gleiche wollen. So kamen bei uns immer mehr Menschen zu den Demonstrationen. Und ich glaube, dieser gemeinsame Wille gilt bei allen politischen Auseinandersetzungen. Man muss überzeugen können, dass jemand anderer den Schritt mitgeht, den ich gehe. Wenn ich dabei festgenommen werde und wenn das nicht bekannt wird, dann hat der Gewalthaber Macht. Doch wenn es bekannt wird, dann ist es Teil seiner eigenen Delegitimation. Deshalb muss man alles dafür tun, dass Gewaltvorgänge öffentlich werden.
Damals hatten wir keine Smartphones, um Filme zu machen konnte. Wir hatten ja nicht einmal unabhängige Journalisten im Land. Die Möglichkeiten waren begrenzt.
Heute sehen wir in Weißrussland, dass sie wieder über Mittelwelle senden, wenn das Internet abgestellt wird. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube, die wichtigste Aufgabe bei Protesten ist, kommunizieren zu können.
Doch die eigentliche Herausforderung besteht danach, vertrauenswürdige Institutionen zu schaffen. Was ich damit meine: kann ich der Polizei trauen oder nicht? War die Wahl demokratisch? Das sind Fragen, die nicht mit Massenprotesten gelöst werden.
Bei uns gibt es ja auch Misstrauen gegenüber der Polizei, in manchen Fällen berechtigt, in anderen nicht. Aber das ist eine andere Ebene der Auseinandersetzung. Heute ist die Situation eine andere.
Der Unterschied besteht darin, dass es damals überhaupt keine Möglichkeit gab, die Polizei zu kontrollieren. Das war ein staatlicher Sicherheitsapparat, in dem die Polizei sozusagen eigenständig handeln konnte. Da gab es kein Kontrollgremium, an dem normale Bürger beteiligt waren. Heute ist das anders. Ich würde sagen, wir sind jetzt in der Situation, dass es jemanden gibt, der Verantwortung trägt und persönlich benannt werden kann. Früher war ja keiner wirklich verantwortlich. Ich finde, das ist schon ein sehr großer Erfolg.
Hatten Sie damals Angst?
Mein Ansatz war, wenn Gewalt ausgeübt wird, dann ist das ein Punkt für uns. Gewalt delegitimiert diejenigen, die sie ausüben. Meine Freunde meinten, du bist ja optimistisch. Ich dachte immer, das kann nur gut für uns ausgehen. In dem Sinne hatte ich keine lähmende Angst um mich, aber ich nahm Rücksicht auf andere. Ich muss mein Handeln sehr gut abwägen.
Ich hatte vorhin gesagt, dass Freunde wieder aus dem Gefängnis kamen, was aber nicht heißt, dass danach noch andere Menschen inhaftiert wurden, die nicht entlassen wurden. Diktatorische oder autoritäre Macht lebt von Angst. Deswegen ist es wichtig, diese Angst zu überwinden. Ich kann für mich sagen, dass ich auf Gott vertraute. Ich habe meinem Gegenüber vertraut, dass es gut ausgehen wird.
Zu etwas anderem: Sie schrieben verschiedene Artikel. Wie hat das ohne Internet funktioniert?
Wir haben das selber auf Papier herausgegeben. In den öffentlichen Zeitungen konnte niemand aus der Opposition publizieren. Meinungen waren vorgegeben. Es gab innerhalb der Kirchen die Möglichkeit, etwas zu drucken, oft mit einer Auflage von unter 100 Exemplaren. Das war also sehr primitiv. Und da, wo ich mich engagierte, wollten wir den kirchlichen Raum überwinden.
Aber wir hatten jemanden in einer Druckerei, der mit der Stasi zusammenarbeitete. Die Geheimpolizei hatte Möglichkeiten, einen Druck zu verhindern. Die Kommunikation und die Artikulation eigener Gedanken ist eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung von Widerstand. Die eigene Wahrheit ist Teil jeder Revolution.
Mit dem Internet ist es heute einfacher. Allerdings kann man leider auch sehen, wie viele Verschwörungstheorien im Internet grassieren. Aber die Frage ist doch: geht davon Gefahr aus? Ab wann wird so etwas gefährlich. Im Fall einer Verschwörung heißt das, dass ich der Realität nicht auf den Grund gehe. In einer freien Gesellschaft, im offenen Diskurs, wird das aber nicht lange funktionieren. Erst wenn ich mich abschotte und nur noch das lese, was ich glauben will und was mich bestätigt, kann eine Verschwörung in Umlauf geraten. Wie soll man damit umgehen? Ich glaube, es ist wichtig, über Fake News aufzuklären. In einer offenen Gesellschaft muss man keine Angst davor haben.
Gab es seitens des Staats Angebote, mit den Demonstrationen aufzuhören?
Es gab natürlich Versuche der Staatssicherheit, Einfluss zu nehmen. Zum Beispiel in der Kirche. Menschen kommen zum Gottesdienst zusammen und gehen dann gemeinsam demonstrieren. Es gab Versuche, die Kirche davon zu überzeugen, dass sie damit aufhört.
In meinem Fall: mit 18 Jahren stellte ich einen Ausreiseantrag, weil ich kein Abitur bekam und deshalb in den Westen wollte. Später zog ich den Antrag zurück. Die Stasi wusste nicht so richtig, wie sie mit mir umgehen soll. Und so bekam ich das Angebot zur Ausreise, was andere liebend gerne angenommen hätten. Doch ich habe mir gesagt, erst wenn alle ausreisen können, mache ich das auch.
Ein anderer Versuch der Einflussnahme war, Leute in Haft zur Ausreise zu zwingen.
Was hat es mit der Aufarbeitung der SED auf sich? Worin besteht diese Arbeit? Der Begriff ist sehr schwer zu übersetzen.
Damit ist die Auseinandersetzung mit der Geschichte gemeint. Meine Aufgabe besteht zum Beispiel in der Arbeit mit Menschen, denen Schaden zugefügt wurde. Das ist ein sehr individueller Prozess. Man kann Aufarbeitung aber auch gesamtgesellschaftlich betrachten.
Aufarbeitung hat in Deutschland einen geschichtlichen Hintergrund, nämlich den des Nationalsozialismus. Das heißt, wie gehe ich damit um, dass mein Land so viel Unheil in der Welt angerichtet hat. Das ist heute ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Es geht um die Verantwortung im Kontext unserer Mitbürger und Nachbarn. Das ist eine sehr spezifisch deutsche Aufgabe. Aber ich wünschte mir, dass es so etwas auch in den ehemaligen Ländern der Sowjetunion in deren geschichtlichen Kontext gemacht wird.
Für mich ist Aufarbeitung an den Grundgedanken gebunden, Verantwortung zu übernehmen. Man muss verstehen, dass das, was ich tue, Auswirkungen hat und ich dafür Verantwortung tragen muss. Wenn das in der gesamten Gesellschaft praktiziert wird, haben wir eine souveräne Gesellschaft.
Wie war das damals mit dem kirchlichen Widerstand. Was bedeutet das genau?
„Kirchlicher Widerstand“ hört sich so an, als wäre ein Teil der Kirche im Widerstand gewesen. Aber sie war Widerstand, denn aus dem atheistischen Selbstverständnis der Kommunisten konnte sie nicht anders. Dennoch wissen wir heute, dass die Kirche auch Anteil an der Macht hatte. Aber es gibt Unterschiede. Zum Beispiel war der Machtanteil der orthodoxen Kirche höher als der der katholischen Kirche. Zwischen den Konfessionen bestehen doch deutliche Gegensätze.
Aber mein Thema ist nicht, wie Institutionen Widerstand leisten, sondern wie die Kirche als Institution Menschen darin bestärken kann, Widerstand zu leisten. Mein Glaube befähigt mich Dinge zu tun, die sich andere einfach nicht trauen. Es gibt eine besondere Kultur, Menschen selbst zu ermächtigen. Deswegen darf es in einer Diktatur keine Kirche geben. Sie wird praktisch aufgelöst.
Gab es von staatlicher Seite Unterschiede bei der Behandlung der Konfessionen?
Unterschiede gab es schon. Das lag einfach daran, dass der Staat jeweils anders auf eine Konfession regierte. Zum Beispiel die Zeugen Jehovas. Sie wurden in der Hitlerzeit verfolgt und wurden in der DDR 1950 wieder verboten. Dennoch gibt es sie noch heute.
Ich würde aber nicht sagen, dass die evangelische Kirche besser oder schlechter behandelt wurde, als die katholische Kirche. Die katholische Kirche konnte aber zum Beispiel in Polen manches machen, was die katholische Kirche in der DDR nicht machen durfte. In Polen gab es die beste katholische Ausbildung. In Tschechien wurden hingegen ganze Klöster geschlossen. Und wer sich dort in der Kirche engagierte, wurde quasi in ein Konzentrationslager gesteckt. Das Klosterleben wurde brutal niedergeschlagen.
Rechtspopulisten versuchen heute das Erbe der friedlichen Revolution zu vereinnahmen. Was sagen Sie dazu?
Ich würde sagen, dass die Tatsache, dass man im Nachhinein an der friedlichen Revolution partizipieren möchte, doch ein sehr schönes Zeichen ist. Das ist der Erfolg unserer Geschichte.
Wer heute versucht, auf den Zug aufzuspringen, bekommt Aufmerksamkeit. Allerdings hängt diese Vereinnahmung wohl auch mit der Hoffnung zusammen, die Gesellschaft mit Hilfe fremder Mächte zu gestallten. Eigentlich ist das nicht souverän. Das hat viel mit den Menschen zu tun, die dort mitmachen.
Vielen Dank für dieses interessante und aufschlussreiche Gespräch. Das war für uns persönlich und unser Projekt sehr wichtig.
Herzlichen Dank! Mir geht hat ebenso. Ich bin auch dankbar dafür, dass sie es mit der Aufarbeitung ernst meinen.