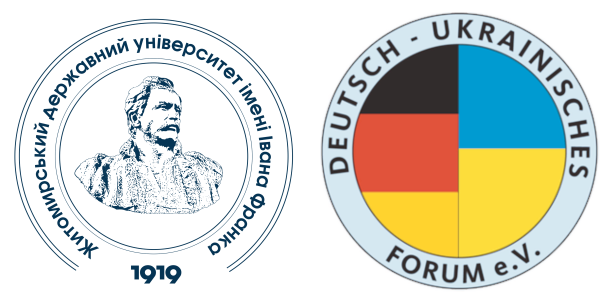Frage: Wann ist Ihr Interesse an Politik und Journalismus entstanden?
Schefke: Das Leben in der DDR als Diktatur war für mich eigentlich immer politisch. Und politisch heiß, dass man sich damit auseinandersetzt, in welcher Situation sich das Land gerade befindet und dass man als junger Mensch an seine Grenzen stößt, indem das Land eben eingemauert war. Es gab ja nicht nur die Berliner Mauer, sondern die ganze DDR war eingemauert. Dabei hat diese Mauer nicht nur einen Staat vom restlichen Europa getrennt, sondern auch Familien. Und Familie heißt in meiner Situation, dass alle Geschwister meines Vaters in Westdeutschland lebten. Sie gingen 1961, also vor dem Mauerbau, in den Westen. Und auch meine Großeltern haben sich, wie man so schön sagt, „rübergemacht“. Deshalb waren Mauer und Unrechtsstaat bei uns immer ein Thema. Und mit 16, 18, 20, entscheidet man sich, ob man sich mit dieser Diktatur, diesem Sozialismus, diesem Land arrangiert oder ob ich das einfach nicht will. Nun kann man versuchen, auch in den Westen zu gehen, wenn man das nicht will, oder man bleibt im Land. Und ich habe mir immer gesagt, das ist auch mein Land, wo ich auch ein Haus habe, und weshalb soll ich das dem Staat schenken?
So gibt es in jedem Leben Schlüsselmomente, wo man für sich eine „Rote Linie“ festlegt. Wenn diese vom Staat überschritten wird, dann sagt man sich, so und jetzt nicht weiter; ich wehre mich. Und ich habe versucht, Gleichgesinnte zu finden.
Damals war die Situation so, dass es in Ostdeutschland nur fünf Fernsehsender gab – zwei aus der DDR und drei aus dem Westen, wobei nur die drei aus dem Westen geschaut wurden. Und die Idee war, über das Westfernsehen zu zeigen, was in der DDR vor sich geht. Es ging darum, die DDR-Bürger zu ermuntern, sich nicht mit der Mauer, mit Stacheldraht und der Staatssicherheit abzufinden.
Frage: Gab es bei Ihnen eine konkrete Situation, die Sie dazu gebracht hat?
Schefke: In der DDR konnte man erst in den Westen reisen, wenn Du mit 65 Jahren in Rente gegangen bist. Dann konnte Dich der Staat nicht mehr gebrauchen und Du hast nur noch Geld in Form von Rente gekostet. Und wenn man nun 20 Jahre alt ist, kann man sich ausrechnen, dass man noch 45 Jahre warten muss, um zu seiner Oma in den Westen zu fahren. Aber mir war klar, dass sie dann nicht mehr leben wird. Also werde ich nie meine Oma persönlich kennenlernen. Und da habe ich mir gesagt, nein, das will ich nicht, das muss sich ändern, denn das kann nicht sein. Du bist in Berlin, stehst am Brandenburger Tor und nur 80 Meter trennen zwischen Freiheit und Unfreiheit.
Auf einer Reise nach Ungarn kaufte ich mir Bücher aus Westdeutschland von dem wenigen Geld, das ich als Student hatte. Ungarn war damals viel offener als die DDR. Und dann kam so ein DDR-Zöllner an der Deutsch-Tschechischen Grenze und nahm mir die Bücher weg. Das war der Moment, wo ich mir sagte, das will ich nie wieder.
Es war auch nicht so leicht beim Studium. Ich bin Bauingenieur und in unserer Seminargruppe waren von 21 Studenten 18 in der Partei. Da wurde mir das Leben doch schon ganz schön schwer gemacht.
Frage: Wann kamen Sie erstmals mit der Stasi in Berührung und welchen Einfluss hatte das auf Ihr Leben?
Schefke: Für uns gab es mit Westverwandtschaft immer ein Fenster zum Westen, auch über das Westfernsehen. Nun stell Dir vor, Du schreibst Deiner Oma und 14 Tage später bekommt sie den Brief. Dabei sagten mir meine Eltern immer, dass die Stasi diese Briefe mitlesen. Ich glaubte das nie, denn als Kind verstand ich nicht, wie sie das aufbekommen. Doch als ich 1992 meine Stasi-Akte bekommen habe, lagen dort sehr viele Briefe als Kopie oder als Abschrift dabei. Es gab also immer eine Ahnung, eine Art Gerücht. Deshalb meinten meine Eltern zu mir, dass ich nicht alles schreiben darf. Man konnte sich das alles gar nicht vorstellen, dass die Stasi alles mitliest und mithört. Doch nach der Öffnung der Stasi-Akten 1992 lag der Beweis auf der Hand.
Beim Studium wurde versucht, die neuen Studenten für die Staatssicherheit anzuwerben. So ein Gespräch hatte ich auch. Da war ich total verwundert. Dabei wurde mir gesagt, wenn Du bei der Stasi bist, schaffst Du natürlich Dein Studium und wenn Du nicht mit uns kooperierst, wissen wir nicht, ob Du Deinen Abschluss bekommst. Das machte natürlich ein bisschen Angst, aber es war auch gar nicht so schwer, nein zu sagen. Das hatte für mich die Konsequenz, dass ich mein Studium erstmal unterbrechen musste. Also spätestens mit dem 20. Lebensjahr wusstest Du, dass die Stasi ein Auge auf Dich geworfen hatte. Vor allem wenn Du Leiter oder Chef in einem staatlichen Betrieb wirst.
In meinem Fall glaubte ich, dass sich die Stasi erstmal nicht mehr für mich interessiert. Am 9. September 1986 gründeten wir allerdings eine Umweltgruppe, die sich mit ökologischen Themen beschäftigte. Letzten Endes waren wir aber politisch. Wir dachten nämlich, dass man nichts gegen eine gute Umwelt haben könne. Und 1992 fand ich in meiner Stasi-Akte, dass man darüber sehr genau Bescheid wusste.
So eine Stasi-Akte muss man sich als eine Ansammlung von Verrat vorstellen. Freunde, die Dich denunziert und Material gegen Dich gesammelt haben, damit Du letztlich im Gefängnis landest. So eine Akte in Leitz-Ordnern hat zirka 300 Seiten. Und meine Akte besteht aus 8 Leitz-Ordner, also 2400 Seiten, die über drei Jahre geschrieben wurden. Letztendlich waren sie schon ein bisschen verrückt.
Aber auf dieser Akte stand jetzt nicht mein Name, sondern ein Deckname. Und so eine Akte hieß „Operativer Vorgang“. Jeder, der als „Operativer Vorgang“ geführt wurde, hatte also auch eine Akte. Davon gab es in der DDR nun wieder auch nicht so viele. Ich sage immer etwas ironisch: „nur die Besten“. Und meine Akte hieß „OV Satan“. Das zeigt wohl ein bisschen, wie man mich einschätzte.
Frage: Würden Sie mit dem Wissen von heute alles gleich oder etwas anders machen?
Schefke: Ich denke, ich würde noch eine Schippe drauflegen und etwas mehr riskieren. Aber eigentlich muss ich auch sagen, mit dem Wissen der Stasi-Akte, ging eigentlich nicht mehr. Damals gab es ja auch keine Smartphones, Briefe wurden gelesen und die Kommunikation war enorm eingeschränkt.
Damals war ich einer der wenigen, der eine Videokamera hatte. Die kostete sehr viel Geld. Es war enorm schwierig, das alles zu organisieren. Vor allem Geld, denn so eine Revolution kostet ja auch etwas. Es war ein recht anstrengendes Leben.
Vor dem Mauerfall hatte ich vier Jahre lang daran gearbeitet, dass die Mauer fiel. In jener Zeit hatte ich vielleicht fünf Stunden am Tag geschlafen. Mein Kopf arbeitete ständig daran, wie man was macht. Wie bekommt man die Videokassette in den Westen, wie werden die dort bearbeitet, wie werde ich überhaupt zum Kameramann, wie lerne ich eine Kamera zu bedienen… Zum Verständnis: Gib mal Deiner Oma das neueste Smartphone und bitte sie, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen. Das kann sie wahrscheinlich nicht auf Anhieb. Und so war das auch mit der Kamera. Ich wusste zwar, wie das Ding anging, aber mehr auch nicht. Das musste ich erst lernen.
Frage: Können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie sich damals fühlten?
Schefke: Ich bin eigentlich ein Mensch, der nach Vorn schaut. Ich versuche Leuten zu vermitteln, dass unsere Situation damals aussichtslos war und dass wir es trotz allem geschafft haben. Ich mache so ein Rückblick ganz gern zu Fünfjahrestagen. Dabei werde ich auch immer wieder eingeladen, auch ins Ausland. Es ist schon gut, vor 400 Leuten bei Google über Überwachung zu sprechen und was so etwas anrichten kann. Ich nutze auch gerne die Gelegenheit, vor jungen Menschen zu reden, um von meinen Erfahrungen zu berichten, dass sich Widerstand lohnt. Freiheit ist dabei das Wichtigste, wobei das viel mit offenen Grenzen zu tun hat. Ohne offene Grenzen gibt es keine Freiheit.
Bei Gesprächen mit wichtigen Leuten bin ich manchmal etwas emotional, damit sie sich auch wirklich für das Thema interessieren. Denn teilweise erzähle ich denen etwas, was ihnen gar nicht so richtig gefällt. Außerdem kommen natürlich Emotionen auf, wenn man einen Preis verliehen bekommt. Und dann habe ich noch Kinder im Studentenalter, die nicht immer Geschichten von damals hören wollen. Deshalb suchen wir uns jeden Sommer ein Thema, das wir gemeinsam bearbeiten, damit sie letztlich politische Menschen werden.
Frage: Was ist Ihrer Meinung nach bei der Wiedervereinigung damals nicht so gut gelaufen und was hätte man besser machen können?
Schefke: Das Problem war damals einfach, dass die Zwänge unheimlich groß waren. Es gab das DDR-Geld, das keiner haben wollte, und es gab das Westgeld, mit dem man grundsätzlich mehr anfangen konnte. Im Frühjahr 1990 gab es Demonstrationen mit dem Motto „Kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zu ihr“. Es gab damals eine unheimliche Fluchtbewegung von monatlich 50.000-100.000 Menschen, die in den Westen gingen. Und um die Leute zu halten, musste man etwas machen. Niemand wollte mehr DDR-Waren kaufen, selbst Eier oder Butter nicht. Alles musste aus dem Westen sein. Es fehlte einfach an Zeit.
Die Häuser waren alle verfallen, die Umwelt kaputt, die Luft war schlecht, in der Elbe konnte man damals weder angeln noch baden… Es war alles verseucht und verschmutzt… Über die schreckliche Umweltsituation in der DDR habe ich viele Filme gemacht. Die Leute wollten das einfach nicht mehr. Aber wie will man es schnell anders machen? Das funktioniert nur über Geld, viel Geld…
Was hätte man nun anders machen sollen? Länger warten? Die DDR-Mark länger künstlich am Leben halten? Ich finde, es wurde gar nicht so viel falsch gemacht. Man hätte vielleicht die DDR-Bürger mehr am Staatseigentum beteiligen sollen. Die Aufteilung der Kombinate hätte besser laufen können.
Sicher ist es nicht schön, dass von 164 Universitätsrektoren nur fünf aus dem Osten sind. Es ist nicht in Ordnung, dass die Seilschaften im Osten nicht da sind. Der „Wessi“ hat in Gesamtdeutschland einfach Schlüsselpositionen inne. So gibt es kein einziges DAX-Unternehmen im Osten. Aber die verdienen das Geld. Es ist sicherlich noch nicht gerecht.
Aber zum Beispiel bei meinen Kindern spielt Ost/West keine Rolle mehr. Man bereist Deutschland.
Letztendlich bin ich zufrieden, wie es gelaufen ist. Es war zwar schmerzhaft, aber ich hatte auch Glück mit meiner Arbeit und war nie arbeitslos in meinem Leben.
Frage: Hatten Sie vor, die DDR vor dem Mauerfall zu verlassen?
Schefke: Naja, ich glaube, jeder DDR-Bürger hat mindestens einmal am Tag darüber nachgedacht diesen beschissenen Osten, diese beschissene, blöde, kranke DDR zu verlassen… Aber ich habe mir gesagt: das ist doch meine Heimat und die gibt man nicht so schnell auf. Ich hatte noch ein bisschen Kraft um mich zu wehren und um zu sagen: „Das ist auch meins und nicht Euers“. Ich wollte schlicht und einfach kämpfen.
Frage: Wann war Ihnen klar, dass es keine Zwei-Staatenlösung geben wird?
Schefke: Mir war es bereits am nächsten Tag klar. Ich fragte mich dabei, welchen Sinn zwei deutsche Staaten ergeben hätten. Die Menschen in der DDR hatten keine Lust mehr, als Versuchskaninchen in einem neuen sozialistischen Experiment teilzunehmen. Sie wollten einfach nur Mercedes, Westgeld und Bananen haben. Die DDR hatte einfach keine Existenzberechtigung mehr, warum auch?
Frage: Hatten Sie damals nicht Angst vor der Stasi, als sie die Videos drehten? Hatten Sie Vorsichtsmaßnahmen getroffen?
Schefke: Mir war die Sache mit der Stasi damals gar nicht so richtig bewusst. Was nicht heißt, dass ich nicht sehr vorsichtig war. Vor allem bei der Auswahl von Freunden. Ich war oftmals sehr verschlossen und einsam. Von der Aktion in Leipzig wusste nur mein Freund Aram (Radomski) etwas und als wir die Bilder im Westfernsehen sahen, trauten wir uns nicht einmal uns wirklich laut zu freuen. Wir dachten, unsere Wohnung wird abgehört.
Außerdem spielen ja mit 25, 30 Jahren auch Frauen eine Rolle. Heute weiß ich aus meiner Stasi-Akte, dass sich Frauen meine Freundschaft und Zuneigung erschleichen wollten, weil sie dafür bezahlt wurden. Das ist natürlich auch ein Ausmaß menschlicher Tragödien, denn die Frauen haben das ja auch nicht freiwillig gemacht.
Zu den Vorsichtsmaßnahmen… Man muss sich das so vorstellen, dass ich eine Wohnung im vierten Stock in Ostberlin hatte. Im Innenhof des Hauses stand die Stasi. Immer wenn ich raus ging, ist mir die Stasi gefolgt. Also musste ich mir etwas überlegen, wie ich unbemerkt von der Wohnung wegkomme. Fündig wurde ich auf dem Korridor mit einer Dachluke.
An diesem berühmten 9. Oktober ging ich über die Dächer 10 Häuser weiter. Die Wohnung präparierte ich mit Weckern, die das Licht an und ausmachten und Musik, bzw. den Fernseher laufen ließen. So dachte die Stasi auf dem Hof, als es dann dunkel wurde, dass ich in der Wohnung arbeite. Ich traf mich dann mit meinem Freund Aram und tauschten auf der Fahrt nach Leipzig noch das Auto.
In Leipzig wollten wir einen guten Punkt zum Filmen haben und fragten den Pfarrer der Kirche, ob wir auf den Turm können. Im Taubendreck filmten wir dann und wussten weder, ob auf den Aufnahmen etwas zu sehen sein wird oder ob geschossen wurde (wir sahen Militär und Soldaten in den Seitenstraßen). Aber Aram sagte zu mir, wenn diese Bilder am nächsten Tag im Fernsehen laufen, dass dies nicht nur die DDR und Deutschland verändern wird, sondern Europa und die ganze Welt. Und tatsächlich waren diese Aufnahmen der finale Beweis, dass in Leipzig demonstriert wurde.
Übrigens: Die Zahl 70.000 Demonstranten haben wir festgelegt. Im Vorfeld haben wir uns darauf geeinigt, dass es eine glaubwürdige Zahl sein soll. Der Vorschlag von 30.000 erschien uns zu wenig, aber 100.000 waren doch zu viel.
Als ich dann wieder in Berlin über die Dächer in meiner Wohnung ankam, schaute ich aus dem Fenster und die Stasi stand immer noch im Hof. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt, dass die Kassette in Westberlin angekommen war.
Im Fernsehen kam dann wirklich ein Bericht aus Leipzig, wobei anmoderiert wurde, dass es einem italienischen Kamerateam gelang, unglaubliche Bilder von den Demonstrationen in den Westen zu senden. Wir konnten das nicht glauben, dass auch ein ausländisches Kamerateam dort war und waren fast deprimiert. Doch als die ersten Bilder zu sehen waren, wurde uns klar, dass das unsere waren. Man hatte bei der Anmoderation zu unserem Schutz ein bisschen geflunkert.
Frage: Dann noch ein aktuelles Thema: Wie würden Sie die Situation in Belarus beurteilen? Im Hinblick auf Ihre Erlebnisse in der DDR?
Schefke: Diktaturen sterben aus. Ich war erstaunt, dass es in Spanien bis 1975 eine faschistische Regierung gab. Das ist doch unglaublich. Aber wenn man Diktaturen einmal betrachtet, so sind Diktatoren irgendwann tot. In der Regel werden sie erschossen oder fliehen mit vielen Millionen Dollar in ein Land, wo sie ihren Lebensabend verbringen können. Aber alle Diktatoren haben die negative Eigenschaft, dass sie davor etliche Tausend oder gar Millionen Menschen getötet haben, so wie es bei Hitler und Stalin geschah. Das ist furchtbar.
Ich habe gerade heute etwas zu Belarus gesehen. Dort leben nur 9 Millionen Menschen, also dreimal Berlin. Aber das Problem dieses Landes ist, dass der Diktator seinen eigenen politischen Raum geschaffen hat: seine Minister, Staatssekretäre, Frauen, Geliebte, Töchter und Schwiegersöhne. Das will er natürlich nicht aufgeben. Der ganze Apparat gehört dazu. Die alle wollen weiter Geld scheffeln und unter sich aufteilen. Deshalb werden sie sich bis zum Schluss wehren. Aber in jedem Kampf spielt die Armee eine Schlüsselrolle.
Natürlich, kann man nicht alles vergleichen. Damals hatte die DDR 17 Millionen Einwohner. Nehmen wir an, die Hälfte davon Männer. Also 8,5 Millionen. Und davon ziehen wir Kinder bis 18 Jahren ab, und Rentner über 60 Jahren. Also haben wir 5 Millionen Männer zwischen 18 und 60 Jahren. Davon waren 165.000 bei der Nationalen Volksarmee, 100.000 bei der Staatssicherheit und 200.000 inoffizielle Mitarbeiter der Stasi, sogenannte „Feierabendgeheimdienstler“. Dann gab es 300.000 ältere Menschen mit Waffen zu Hause, was bei uns Kampfgruppe hieß. Dazu muss man noch 500.000 sowjetische Soldaten rechnen. Letztlich haben wir zirka eine Million Männer mit Waffen. Und wir wollten mit 20 oder 100 Leute die Mauer einreißen. Das ist Quatsch. Illusorisch. Wahnsinn
Wir hatten in DDR zum Glück keine Toten. Aber in Rumänien starben in wenigen Tagen fast 1000 Menschen. Man kann leider nur hoffen… Aber alles ist möglich. Und heute gibt es Smartphones und hochauflösende Videos, wie man jetzt aus Belarus sieht.