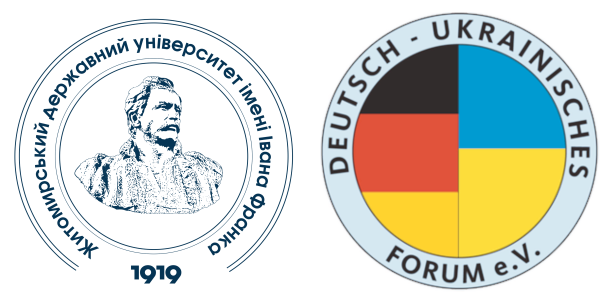Wann dachten Sie zum ersten Mal daran, Fotos von der „Revolution auf Granit“ zu machen? Und wie kamen Sie eigentlich zum Fotografieren?
Heute beschäftige ich mich mit Geschichte und hauptsächlich mit der Geschichte der Fotografie: das sind Studien zur Geschichte von Kyjiw in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zur Fotokunst in Kyjiw von damals. Außerdem fotografiere ich heute Exponate in Museen und restauriere Musikinstrumente. Zum Fotografieren kam ich erstmals 1990. Ich war in jener Zeit in der letzten Schulklasse und wusste noch nicht genau, was ich studieren wollte. Außerdem war mein Vater Fotograf und hat mir einige Sachen beigebracht.
Welche Fotografen haben Sie beeinflusst?
Das war vor allem die baltische Schule der Fotokunst (Litauen, Lettland, Estland). Diese Fotografen haben anders gearbeitet als es in der Sowjetunion damals offiziell anerkannt war. Interessant fand ich auch die tschechische Schule der Fotokunst zur Mitte des 20. Jahrhunderts. Aber ausländische Fotokunst war in der Sowjetunion selbst in den letzten Jahren ihres Bestehens kaum zugänglich, und ich erfuhr zum Beispiel über die französische Fotokunst des 20. Jahrhunderts erst in der unabhängigen Ukraine. Als ich mich über die Geschichte von Kyjiw informierte, lernte ich eine Reihe Kyjiwer Fotokünstler um die Jahrhundertwende (19.-20. Jh.) kennen, über die nur wenig etwas wissen. Aber es ist äußerst interessant, dass sie hier die ersten Fotokünstler waren.
Wie war das Jahr 1990 für Sie?
Heute, wenn ich auf die damalige Zeit zurückblicke, kann ich wohl sagen, es war das beste Jahr meines Lebens! Ich war 17, und das ist an sich schon wunderbar.
Das war zum Ende der Sowjetunion, und man konnte bereits den Wind der Veränderungen spüren: die sowjetische „Perestrojka“, die ersten Keime einer freien Presse, es erschienen erste kritische und provokative Publikationen, es wurden Bücher aus dem Giftschrank veröffentlicht… Ich lernte Gleichgesinnte kenne, die genauso nach Freiheit strebten: wir fanden es einfach seltsam, dass jemand bestimmen wollte, was wir lesen, hören, sehen. In Kyjiw entstanden ab 1987 verschiedene Vereine und Organisationen: der Ukrainische kulturologische Klub, die Ukrainische Helsinki-Gruppe, später – „Aufrichtige Bruderschaft“. Wir begriffen, dass das finale Ziel alle dieser Organisationen eine unabhängige Ukraine war.
Konnte man in der Gesellschaft damals eine Spannung und Nähe zu den Veränderungen spüren?
Ja, natürlich. Die Dynamik der Veränderungen war sehr stark: alles, was geschah, wurde als heftiger Strom empfunden, denn davor lagen die Jahre und Jahrzehnte einer veränderungslosen Breschnjew-Zeit, in der sogar Gedanken an solche Ereignisse wie 1990 mehr als skurril erschien. Und Versammlungen mit ukrainischer Symbolik oder blau-gelben Bändern konnte man sich gar nicht vorstellen. Aber plötzlich gab es im März 1989 eine Aktion am Askold-Grab. Es war eine Versammlung der Ukrainischen Helsinki-Gruppe, der Demokratischen Ligue. Trotz der großen Zahl an Polizisten gab es bei der Aktion keine Verhaftungen. Im Mai 1989, bei der Umlegung des Grabs unseres ukrainischen Nationaldichters Taras Schewtschenko, versuchten Mitglieder des Vereins „Die Gemeinde“ blau-gelbe Fahnen zu tragen. Bereits im August 1990 konnte man diese Fahnen tragen, aber es war trotzdem noch möglich, dafür eine Strafe zu bekommen. Doch im Oktober 1990, bei der ersten Tagung der proukrainischen Partei „Narodnyi Ruch“, wurden solche Fahnen geduldet. Und 1990 konnte man solche Fahnen ganz offiziell am Rathaus in Lwiw hissen. Wenige Tagen später wehte die Fahne auch in Kyjiw.
Kommen wir auf das Jahr 1990 zurück: jedes Wochenende fanden irgendwelche Versammlungen, Demonstrationen oder Tagungen statt. Und es war klar, dass das sowjetische System kurz vor dem Zusammenbruch stand. Es gab ganz unterschiedliche Probleme, unter anderem auch wirtschaftliche. Aber während der „Revolution auf Granit“ ging es nicht darum. Die Forderungen waren vor allem politisch, wie zum Beispiel, dass Ukrainer den Wehrdienst nur auf ukrainischem Territorium leisten dürfen. Dazu kamen Versuche der kommunistischen Partei und des Komsomol, sich zu demokratisieren und somit die blitzartige Entwicklung der Ereignisse etwas zu verlangsamen. Man wollte Reformen, um die Lage so zu retten. Aber es gab bereits nichts mehr zu retten.
Was war und wurde die Revolution für Sie? Eine Evolution der Ansichten und Haltungen gesellschaftlicher Aktivisten?
Das war die erste große Aktion, die eine wesentliche Wirkung auf das „hier und jetzt“ hatte. Die Erfüllung der Forderung, dass die Regierung von Massol abdanken soll, war in der Sowjetunion beispiellos. Das hatte enorme Wirkung. Außerdem verblüffte, dass wir die Gesellschaft aus dem Gleichgewicht bringen, sie wachrütteln und sie von der Haltung „dran haben wir uns gewöhnt“ befreiten konnten. Ja, das war ein langsamer Prozess, aber er brachte schließlich Ergebnisse. Ich möchte hinzufügen, dass für mich persönlich ein „Ergebnis“ der studentischen Revolution die Bekanntschaft mit meiner heutigen Frau war.
Können Sie sich daran erinnern, wie alles anfing? Wann begann die Revolution für Sie persönlich? Gab es einen konkreten Moment, der sich in Ihrem Gedächtnis einprägte?
Am 2. Oktober 1990 legte ich eine Kamera in die Tasche und bin zum Maidan, damals Platz der Oktoberrevolution, gefahren. Dort waren bereits Studenten aus Lwiw, Sumy, Charkiw und aus dem damaligen Dniprodserschynsk. Als alle da waren, setzten wir uns auf den Granit. Gegen Abend stellten wir Zelte auf. Das waren studentische Bruderschaften der Universitäten, die Mitglieder verschiedener Hochschulen hatten.
Welche Rolle spielte für Sie das Fotografieren der Ereignisse?
Ich nahm bekannte und unbekannte Gesichter auf. Später erwies sich das als Fotodokumentation. Damals kamen Reporter zu uns, aber die Fotos eines Laien wurden zu einer Sammlung einzelner Fragmente des Lebens im Zeltlager. Das ist etwas sehr Persönliches und Intimes. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Geschichte aufzeichne: beim Fotografieren gibt es kein solches Gefühl. Aber die Teilnahme am Hungerstreik rief hingegen das Gefühl einer „Volksbewegung“ hervor. Außerdem nahm ich die Gesänge mit einem Diktiergerät auf, was damals ein seltenes Gerät war. Wir sangen sehr viel: Eduard Dratsch, Maria Burmaka, der Opernsänger Pokaltschuk. Diese Ton- und Fotoaufnahmen wurden gemacht, ohne das Gefühl, dass sie wichtig für die Geschichte werden könnten. Das war eben Alltag, eine Geschichte des Augenblicks.
Merkten Sie irgendwelche Veränderungen? Was machte der Hungerstreik mit Ihnen?
Man konnte nur Veränderungen an den Menschen selbst sehen. In ihnen schwand allmählich die Angst. Die Jugend hatte überhaupt keine Angst, aber die ältere Generation war immer sehr vorsichtig, und man weiß warum. Alle strebten nach Freiheit, aber man hatte noch Angst. Und als diese Streiks und Demonstrationen begannen, konnte man sehen, wie sich allmählich diese Angst von ihnen löste.
Aktivierte die damalige Revolution die Gesellschaft? Löste sie schließlich den Prozess zur Unabhängigkeit der Ukraine aus?
Ja, natürlich.
Haben Sie besondere Erinnerungen oder Gefühle?
Ja. Einmal hatte ich Geschmacksillusionen. Ich kann nicht genau sagen, an welchem Tag des Hungerstreiks. Aber ich wachte mit einem deutlichen Geschmack nach Essen im Mund auf. Es schmeckte nach gebratenen Eiern mit Tomaten und Paprika. Wenn man mit Hungern beginnt, spürt man in der Regel am zweiten oder dritten Tag keinen Hunger mehr.
Aber es gab Tee mit Honig und Wasser? Sie mussten ja etwas trinken?
Honig haben wir nicht genommen, weil darin Kalorien enthalten sind. Zuerst tranken wir Hagebutten- und Kräutertee, und später dann nur noch Wasser.
Hatten Sie keine Angst, wirklich verhungern zu können?
Nein, ich hatte keine Angst. Am 5. oder 6. Tag fehlte einfach die Kraft dazu. Auf dem Maidan gab es damals keine WCs. Wir aßen zwar nichts, aber das Wasser und der Tee wollten doch raus. Das nächste WC war aber ziemlich weit entfernt: man musste die Hauptstraße des Kyjiwer Chreschtschatyk überqueren. Also die Unterführung hinunter und dann wieder hoch, über den ganzen Maidan und noch durch eine Unterführung. Und danach wieder denselben Weg zurück. Am 6. Tag fiel es recht schwer, diese Stecke zu bewältigen.
Gibt es Momente, Bilder oder Gerüche, die Ihnen am stärksten im Gedächtnis blieben?
Von den Tönen prägte sich mir die Uhr am Turm des Gewerkschaftsgebäudes ein. Sie schlug jede Stunde, von 7 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Jeden Tag schliefen wir sozusagen mit diesem Uhrschlag ein und wachten damit auf.
Auch die Menschen, die uns umgaben sind mir in Erinnerung geblieben. Unser Zeltlager war mit Wäscheleinen umspannt und wurde zur Kommunismus-freien Zone erklärt. Es gab überall Zusammenhalt und wir fühlten uns eins. Wir waren alle wie Geschwister. Diese Gefühlte prägten die Menschen, jedenfalls die meisten von ihnen, fürs ganze Leben. Später konnte man die viele Teilnehmer der Revolution an ähnlichen Versammlungen und Maßnahmen wieder treffen. Sei es bei der „Orangenen Revolution“ 2004/5 oder bei der „Revolution der Würde“ 2013/14…
Wie sah Ihr Aufenthalt im Zeltlager aus? Gab es einen geregelten Tagesablauf, tägliche Prozeduren oder Ähnliches?
Na ja… Wir wachten gegen 7 Uhr mit dem Uhrenschlag auf. Und wir hatten riesiges Glück mit dem Wetter. Denn es war ja Oktober, aber in der Nacht fiel die Temperatur nicht unter 10 Grad. Und es blieb trocken. Also, wir wachten auf und wuschen uns, tranken etwas und unterhielten uns. Klar, dass so eine große Aktion im Zentrum von Kyjiw nicht unbemerkt bleiben konnte. Es wurde darüber gesprochen und es erschienen Artikel in Zeitungen. Zuerst schrieb man Negatives, so wie etwa „Nichtstuer! Der Staat gibt euch Studienplätze, und ihr veranstaltet Protestaktionen und zeigt öffentlichen Widerstand“. Doch dann kamen immer mehr Leute, die mit uns sprechen wollten.
Außerdem spielte die Kirche eine große Rolle. Die Ukrainisch-griechisch-katholische Kirche, die damals immer noch offiziell verboten war, stellte ein Zelt auf und eröffnete eine Kapelle. Es kam auch die römisch-katholische Kirche aus dem Untergrund, die zwar nicht verboten war, aber sehr stark behindert wurde. Auch „inoffizielle“ Priester der ukrainisch-orthodoxen Kirche gesellten sich zu uns, die damals wiederbelebt wurde. Ich habe irgendwo noch ein Foto eines unikalen stark besuchten Gottesdienstes, wo griechische-katholische, orthodoxe und römisch-katholische Priester zusammen Gottesdienst feierten. Es ist interessant, dass das spontan passierte.
Um auf den Tagesablauf zurückzukommen: wir sangen natürlich viel, sehr viel.
Manche Leute meinen, die Revolution sei ein Fehler gewesen. Sehen Sie eine Gefahr in dieser Einstellung? Gibt es heute in der Ukraine noch Potenzial für revolutionäre Veränderungen?
Selbstverständlich gibt es Menschen, die sich mit einer merkwürdigen Nostalgie an die Sowjetunion erinnern. Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht warum. Es gab viele Diskussionen zu diesem Thema, auch Versuche, die Gründe für diese Nostalgie zu finden. Man einigte sich darauf, dass die Menschen damals einfach viel jünger waren und diese Sehnsucht nach der Vergangenheit eigentlich eine Erinnerung an die eigene Jugend sei.
Ob es eine Gefahr für revolutionäre Veränderungen gibt? In der Ukraine besteht sie immer. Wenn wir die jüngsten Ereignisse als Beispiel nehmen: 2013 deutete eigentlich nichts auf die kommende Zeit…
Wenn Sie an den Ereignissen vor 30 Jahren etwas ändern könnten, würden Sie das tun? Gab es etwas, was schief ging? Hätte man mehr erreichen können?
Wir veränderten bereits sehr viel. Sagen wir so: ein großer politischer Fehler von 1991 war (und heutzutage nennt man das auch so) die Verkündung der Unabhängigkeit. Hätte man damals nicht die Gründung eines neuen, unabhängigen Staates verkündet, sondern die Wiederherstellung der Ukrainischen Volksrepublik von 1918, hätte sich die Ukraine in Außenangelegenheiten ganz anders verhalten können. Das war aber für die damaligen Staatoberhäupter von Vorteil, obwohl sehr viele Menschen und politischen Kräfte daran arbeiteten, dass die Ukraine die 1920 verlorene Unabhängigkeit wiedererlangt. Wäre damals ein anderer Präsident an die Macht gekommen, hätte die Ukraine einen anderen Weg gehen können.
Der Gedanke über die Wiederherstellung eines ukrainischen Staates klingt sehr interessant. Denn in Deutschland ereignete sich etwas Ähnliches: nach der Revolution 1989 kam es zu der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland, und nicht zur Gründung eines neuen Staates. In der Ukraine hätte ein ähnlicher Prozess in Gang kommen können.
Natürlich. Die baltischen Länder, wie Estland, Lettland und Litauen, riefen keine Unabhängigkeit aus. Sie stellten die früher verlorene Unabhängigkeit wieder her. Das verlieh ihnen sofort politisches Gewicht. Sie hatten auf der internationalen Bühne bessere Startmöglichkeiten.